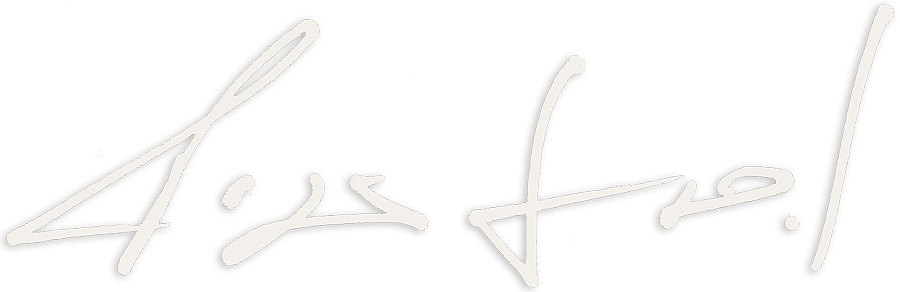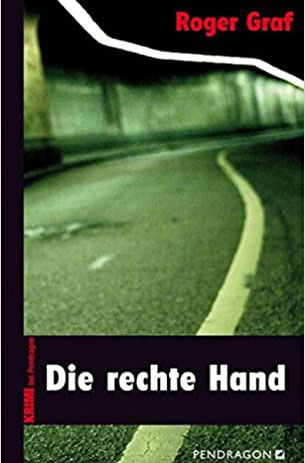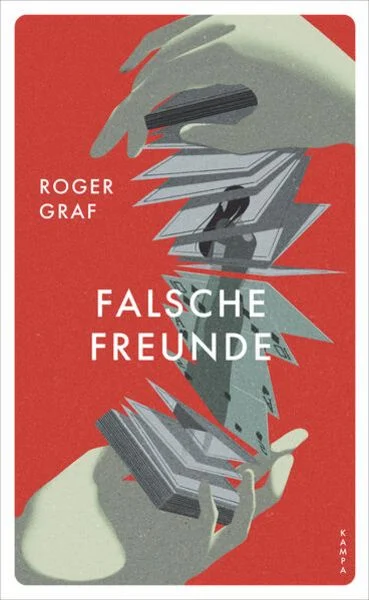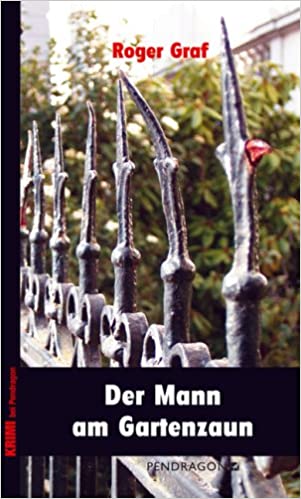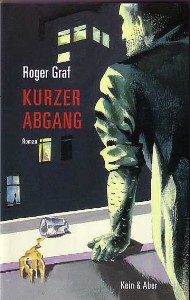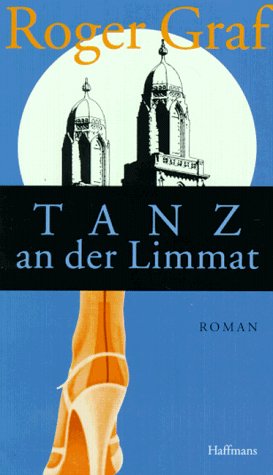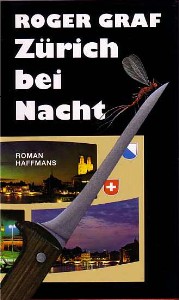Klappentext
Ein schauriger Fund beschäftigt die Züricher Polizei um den Ermittler Damian Stauffer: In der Nähe einer Schrebergartensiedlung wird im Gebüsch eine Hand entdeckt. Die Kripo hat keinerlei Anhaltspunkte, bis ein Sozialarbeiter, der sich eine berufliche Auszeit genommen hat, ermordet wird. Denn plötzlich taucht auf mysteriöse Weise erneut die Hand bei den Ermittlungen auf. Stauffers Team sucht nach Zusammenhängen und entdeckt neue Ungereimtheiten. Stecken private oder politische Motive hinter den Taten? Ein Kriminalroman voller Irritationen, nicht zuletzt auch für Damian Stauffer, dem nicht nur die Ermittlungen in seinem dritten Fall zu schaffen machen.
Auszug
Es kam ihm so vor, als beobachtete ihn der Vogel auf dem Fensterbrett. Da er ständig mit allem rechnete, ging er näher und betrachtete den Vogel, eine Krähe, die keine Anstalten machte wegzufliegen. Er schaute auf die Krähenfüße, doch nichts war daran auffällig. Er hatte davon gehört, dass Brieftauben als Spione eingesetzt wurden, weshalb nicht auch Krähen? Da er niemanden in die Wohnung ließ, der unbeaufsichtigt eine Wanze hätte installieren können, war es naheliegend, dass man ihn auf eine andere Art ausspionieren würde. Doch die Krähe schien weder ein kleines Mikrophon noch eine Minikamera zu tragen. Er überlegte, ob er den Vogel abschießen sollte, fürchtete jedoch den Zorn der Nachbarn; und auf einen Besuch der Polizei konnte er gut verzichten. Unauffällig bleiben war wichtiger als dieser dumme Vogel, der sich wahrscheinlich nur ein wenig erholte oder sich vor dem eisigen Wind schützte. Er trank langsam die Flasche Bier und spürte, wie sich sein Körper entspannte, wie der Rücken weniger schmerzte, wie er ruhiger wurde. Er stand minutenlang still am Fenster und beobachtete die Krähe. Vermutlich hatte das dumme Viech gar nicht bemerkt, dass hinter der Scheibe jemand war. Tiere nahmen die Welt anders wahr als Menschen und das war auch gut so. Er mochte sich nicht vorstellen, was geschehen würde, wenn Tiere die Welt so sehen könnten wie er. Noch während er daran dachte, fühlte er den Abscheu wie eine körperliche Reaktion, so als hätte sein Körper seine Gedanken verinnerlicht, und vielleicht war es auch so. Als die Krähe endlich wegflog, hatte er die Bierflasche geleert. Er stellte sie in den Kasten und zählte die verbleibenden Flaschen. Mehr als drei pro Tag gönnte er sich nicht. Er schaute auf die große Uhr an der Wand und schaltete den Computer ein.
Wöchentlich überprüfte er sein System auf Viren und Trojaner. Dazu ließ er mehrere Programme hintereinander laufen, was bis zu einer Stunde Zeit in Anspruch nahm. Während die Antivirensoftware lief, blätterte er in einem Kochbuch. Ein Standardwerk der italienischen Küche. Er fand ein Rezept, bei dem Fenchel mit Mozzarella überbacken wurde. Auf einem Zettel notierte er sich die Zutaten. Er konnte alles im kleinen Supermarkt an der Ecke kaufen. Das war bei seinem jetzigen Zustand wichtig. Eigentlich hätte er auch alles im Internet bestellen können. Doch er mochte es nicht, wenn jedes Mal jemand anders an der Tür klingelte und ihm die Waren brachte. Im Supermarkt an der Ecke arbeiteten immer die gleichen Leute. Die meisten kamen vom Balkan. Keiner, der auf die alberne Idee kam, ihn nach seinem Namen zu fragen, nur damit er dann jedes Mal laut und deutlich begrüßt werden konnte. Ein Bäcker auf der anderen Straßenseite hatte ihn nach ein paar Monaten nach seinem Namen gefragt. Er hatte ihm einen falschen Namen genannt und war seither nie wieder in die Bäckerei gegangen.
Lächelnd beendete er das dritte Schutzprogramm. Erst als er sicher sein konnte, dass sein System und die Festplatte sauber waren, startete er die Software, mit der er anonym im Internet surfen konnte. Das Programm verschleierte seine IP-Adresse, damit niemand die Spuren bis zu seinem Computer zurückverfolgen konnte. Nur bei perfekter Tarnung ist man dem Feind einen Schritt voraus. Der Satz stammte aus einem der vielen Strategiebücher, die er gelesen hatte. Kriegsstrategien, Guerillakampf und Terror. Darum ging es letztendlich. Diesmal wählte er den Standardbrowser für das Internet. Er hatte mehrere installiert und wechselte ab. Auch das gehörte zu seiner Strategie. Alle Browser waren so eingerichtet, dass nichts gespeichert wurde. Keine Adresse, keine Seite, nichts. Deshalb musste er sich jedes Mal neu einloggen. Es war die Bequemlichkeit, die die Menschen leichtsinnig machte. Alles auf einen Klick. Und schon hat man sich verraten. Als er das Forum aufrief, kontrollierte er zuerst, ob er private Mitteilungen erhalten hatte, was allerdings selten vorkam. Er suchte jene Diskussion, an der er sich seit mehreren Wochen eifrig beteiligte. Niemand wusste, dass er es war, der unter einem anderen Benutzernamen die Diskussion gestartet hatte. Mittlerweile nährte sie sich von selbst, weil sich über ein Dutzend Personen daran beteiligten. Wie verursacht man Chaos? Der Titel war sozusagen Programm. Neben einigen Wirrköpfen beteiligte sich auch ein Student an der Diskussion. Ein kluger Kopf, der analytisch denken konnte und voller Hass war. Er hatte gehofft, auf Leute wie ihn zu treffen. Sie waren es, die in seinen Überlegungen eine wichtige Rolle spielten. Er las den neuesten Beitrag des Studenten.
Chaos entsteht durch Angst. Man muss den Leuten Angst machen. Terror ist Angst. Wenn niemand weiß, wann die nächste Bombe explodiert, wann das nächste Attentat verübt wird. Wie aber instrumentalisiert man die Angst und das Chaos? Entscheidend ist, dass man den Menschen einen Hinweis darauf gibt, wohin der Terror und die Angst führen sollen. Eine politische oder religiöse Botschaft. Versteckt im Blut, das fließt. Doch wer eine Botschaft sendet, hinterlässt Spuren. Ist der perfekte Terror jener, der keine Spuren hinterlässt? Der anonym bleibt, ein unsichtbarer Schrecken, der wütet wie eine tödliche Epidemie?
Der Vergleich gefiel ihm. Der Student hatte zweifellos etwas auf dem Kasten. Aber hatte er auch den Mumm, das umzusetzen, was in der Theorie so gut klang? Spürte er genug Hass oder Leere in sich? Er bezweifelte es. Natürlich gab es genügend junge Kerle, die perfekte Selbstmordattentäter abgeben würden, weil sie mit ihrem Leben nichts anfangen können, weil sie von einem Mädchen gedemütigt worden waren oder gehänselt und unverstanden blieben. Doch das genügte nicht. Für das, was ihm vorschwebte, benötigte er keine Selbstmordkandidaten. Ganz im Gegenteil. Er suchte Typen, deren Abscheu vor dem Leben derart groß war, dass das Auslöschen von Leben nur eine kleine Erleichterung war, die man sich immer wieder gönnte. Wie einen Orgasmus oder ein gutes Essen. Er überlegte lange, ehe er antwortete.
Ein Terror, der sich gezielt gegen Menschen oder Institutionen richtet, bleibt losgelöst vom totalen Chaos. Hat der Terror ein Ziel, dann verliert er an Wirkung. Weshalb sollte ich Angst haben, wenn beispielsweise nur Politiker erschossen werden? Bomben könnten die Angst erhöhen, weil sie immer auch Unschuldige treffen. Der perfekte Terror aber unterscheidet nicht zwischen schuldig und unschuldig. Der perfekte Terror hat kein Muster, ist vollkommen willkürlich. Der perfekte Terror ist wie der Tod. Es kann jeden treffen, jederzeit. Doch wie der Tod würde dieser an sich perfekte Terror eines Tages hingenommen werden als Schicksal, dem man nicht entkommen kann. Deshalb ist es wichtig, wenigstens den Anschein einer Botschaft zu hinterlassen. Sie sollte derart unauffällig sein, dass sie selbst von den gescheitesten Köpfen nicht gelesen werden kann. Einzig die Gewissheit sollte vorhanden sein, dass es sie gibt, die Botschaft. Stell dir vor, der Tod hätte eine derart versteckte Botschaft. Irgendetwas, das wir erahnen, das wir aber nicht entschlüsseln können. Der perfekte Terror ist vollkommen sinnlos, liefert aber winzige Hinweise, die auf einen Sinn hindeuten. Diesen Terror werden die Menschen nicht mehr aus ihrem Kopf kriegen. Er wird sie auffressen und zerstören.
Er las seinen Beitrag mehrmals durch, korrigierte einige Satzzeichen und Worte und schickte ihn schließlich ab. Ohne sich um die anderen Beiträge im Forum zu kümmern, meldete er sich ab und schloss den Browser. Danach schaltete er mit der Fernbedienung die Stereoanlage ein und ließ den metallischen lauten Rock ertönen, den er so sehr mochte. Er stellte sich vor, dass sie nach ihm fahnden würden, während er seelenruhig zuhause saß und laut Musik hörte. Manchmal dachte er auch daran, dass er in einer dieser europaweiten Lotterien mehrere hundert Millionen Franken gewänne und sich damit seinen eigenen Staat aufbauen würde. So wie er das früher gerne am Computer tat. Ein Imperium aufbauen, das er von seinem Computer aus steuern konnte. Keine schlechte Idee für jemand wie ihn, der sich manchmal kaum noch selber steuern konnte. Er wurde immer schneller müde und er hatte festgestellt, dass seine Hände seit zwei Tagen zuckten, als würde jemand Stromstöße in sie hineinjagen. Bis anhin waren alle Symptome nach einer gewissen Zeit wieder abgeklungen, aber jedes Mal befürchtete er, dass irgendwann etwas zurückbliebe. Am meisten fürchtete er sich davor, langsam das Augenlicht zu verlieren oder alles nur noch verschwommen zu sehen. Gab es etwas Hilfloseres als einen blinden Menschen? Aber wahrscheinlich war das auch nur Gewohnheitssache, so wie alles. Auch vor den Blackouts hatte er Schiss. Plötzlich nicht mehr zu wissen, was man die letzte Stunde alles gemacht hat. Sie gehörten zu dieser scheiß Krankheit, auch wenn sie nicht jeden trafen. Es war ein Hohn. Er, der sich nie einfügen konnte und wollte, der immer seinen eigenen Weg ging, bekam eine Krankheit, die genauso individuell war wie er selbst. Die Liste der möglichen Symptome war unendlich, die Progression von Mensch zu Mensch verschieden, deshalb gab es auch keine Prognose. Und was gab es Schlimmeres als diese scheiß Krankheit ohne Prognose? Immerhin musste er sich nicht mehr darum kümmern, wie er über die Runden kam. Die Invalidenrente, die er bezog, war gering, aber er hatte nie auf großem Fuß gelebt.
Er trommelte begeistert den Rhythmus des Schlagzeugs auf den Holztisch. Wie immer in solchen Momenten ärgerte er sich darüber, dass er seinerzeit das Gitarrespielen aufgegeben hatte, bevor er richtig damit begonnen hatte. Auch wenn es vollkommen absurd war, eine Unterlassung zu bedauern, die ihm jetzt sowieso nichts mehr gebracht hätte. Er stand auf und ging zum Fenster. Voller Verachtung starrte er minutenlang auf die Menschen, die sich auf dem Gehsteig bewegten, als hätten sie einen Plan. Was unterschied sie von den seelenlosen Computeranimationen, die in einem Computerspiel Städte erbauten und Kriege führten? Ein paar lausige Emotionen, die so wertlos waren wie der Müll, den sie täglich einkauften und verzehrten. Dabei sehnten sie sich nur nach dem ewig Gleichen: Jemand, der ihrem Leben einen Sinn gibt. Jemand, der sie führt, jemand, der ihr Schicksal steuert und ihnen vorgibt, was sie zu tun haben. Er streckte den Mittel- und Zeigefinger seiner Hand aus und zielte wahllos auf vorbeigehende Passanten. Wer war es wert zu überleben? Spielte es überhaupt eine Rolle? Alle waren sie Todgeweihte, alle gingen sie Schritt für Schritt dem Ende entgegen. Die einen schneller, die anderen geruhsamer. Aber am Ende gab es kein Entrinnen. Seit er die scheiß Krankheit hatte, kam ihm der Tod weniger Furcht erregend vor als zuvor. Nur wer die Angst vor dem Sterben und dem Tod überwindet, ist zu wirklich Großem fähig. Das war ihm klar geworden. Wer den Tod in seinem Kopf überwindet, der schüttelt auch Ethik und Moral ab wie unsinnigen Ballast. Er dachte an Eugen, mit dem er wochenlang Pläne geschmiedet hatte. Pläne für den großen Knall, wie sie es nannten. Seit einem Monat hatte er nichts mehr von ihm gehört. Manchmal dachte er an Eugen wie an seinen besten Freund. Dabei wusste er nur wenig über ihn. Er kannte seinen Hass, seine Wut über die Linken und Ausländer, aber er wusste nichts über Eugens Alltag. Anfänglich hatte er versucht, eine gewisse Regelmäßigkeit in ihren Kontakt zu bringen. Doch Eugen war manchmal wochenlang nicht zu erreichen. Er wechselte auch öfter seine Handynummer. Dann stand er plötzlich vor der Tür und tat so, als sei das ganz normal. Er schaute auf die Uhr. Am Nachmittag kam die Stumme, um sauber zu machen. Sie war auch da gewesen, als Eugen ihn zuletzt besucht hatte. Eigentlich war sie nicht stumm, nur schweigsam. All die anderen Putzhilfen hatte er nicht ertragen. Frauen aus aller Herren Länder, die kaum ein Wort Deutsch verstanden. Einige machten einen enormen Krach, während sie putzten, eine sang dauernd und eine andere fragte ihn ständig nach Putzmitteln, ohne die sie ihre Arbeit nicht verrichten konnte. Die Stumme schwieg und putzte. Unendlich langsam, aber das war ihm egal. Sie lebte von Sozialhilfe und wie er lebte sie allein und zurückgezogen. Ihm war aufgefallen, dass sie Eugen Blicke zugeworfen hatte, als er fluchend über die Regierung herzog und gedanklich Massengräber aushob. Da hatte er die Stumme erstmals als Frau wahrgenommen. Eugen schien nichts zu bemerken und vermutlich hätte es ihn eher gestört. Die Stumme war nicht hässlich und wahrscheinlich war sie auch nicht dumm. Einfach nur langsam. Für solche Menschen gab es keinen Platz mehr, keine Arbeit. Sie waren hoffnungslose Fälle. Ihm war es egal, dass sie dreimal so lange benötigte wie alle anderen Putzhilfen. In ihrer Anwesenheit fühlte er sich nicht gestört. Er konnte lesen, Musik hören, am Computer arbeiten, Selbstgespräche führen. Sie ging nie darauf ein, aber manchmal bemerkte er, dass sie reagierte. Ganz kurz sah er sie vor sich, wie sie mit Eugen zusammen war. Eine absurde Vorstellung. Aber was wusste er schon über Eugen? Über sein Privatleben hatten sie nie gesprochen. Auch nicht bei ihrer letzten Begegnung, als er Eugen von der scheiß Krankheit erzählt hatte. War es das, was Eugen davon abhielt, wieder mit ihm in Kontakt zu treten? Hatte er einen Plan, bei dem er jetzt keine Rolle mehr spielte? Er fluchte laut über sich und die scheiß Krankheit. Aber eigentlich hatte Eugen Recht, wenn er sein Ding ohne ihn durchzog. Am Computer zu sitzen und anonym Hass zu predigen war das eine. Eugen war schon seit Jahren aktiv und er wusste, dass Eugen auch vor Gewalt nicht zurückschreckte.
Er klopfte mit den Fingern den Rhythmus ans Fensterglas. Fenchel mit Mozzarella. Dazu einen guten Weißwein. Er stoppte die Musik, ging in den Korridor und zog sich den Mantel über. Langsam ging er die Treppe runter. Wie immer war er froh darüber, niemandem zu begegnen. Und wie meist begegnete er trotzdem jemandem. Eine rundliche Frau, die oft säuerlich roch und alle Menschen mit einem breiten Grinsen begrüßte. Er nickte nur und ging an ihr vorbei, darauf bedacht, erst wieder vor der Haustür einzuatmen. Wenn diese Menschen wüssten, mit wem sie hier Tür an Tür lebten. Er stellte sich vor, wie sie ihn beschreiben würden, wenn aufgebrachte Reporter wissen wollten, wie das Monster seinen Alltag lebte. Zweifellos würden sie ihn als Monster bezeichnen. Das gehörte dazu. Im Laden unterhielt sich ein älterer Mann mit einer Angestellten. Der Mann sah aus, als hätte er mehrere Kriege überlebt. Ein Blick wie eine Todesanzeige. Die Angestellte tat so, als würde sie das, was der Mann sagte, interessieren. Er sah, wie sie ihn ansah und wie sie ein Lächeln andeutete. Er nickte leicht und ging zum Gemüseregal. Als er alles in eine Plastiktüte gepackt hatte, ging er einmal um den Block. Früher hatte man ihn einen unruhigen Geist genannt, weil er ständig in Bewegung war und Spaziergänge zum täglichen Ritual gehörten. Jetzt hatten sie eine existenzielle Bedeutung. Er wusste, dass diese scheiß Krankheit ihn eines Tages in den Rollstuhl zwingen würde, deshalb waren die Spaziergänge umso wichtiger geworden. Solange er noch gehen konnte, war er in der Lage, aktiv zu bleiben, und sei es nur, um wild um sich zu schießen. Er lächelte kurz bei dem Gedanken, der erste Amokläufer zu sein, der aus dem Rollstuhl schoss, doch sogleich verdüsterte sich seine Miene wieder. Als er stehen blieb, spürte er ein Kribbeln im linken Fuß, was ihm sogleich den Schweiß auf die Stirn trieb. Wie lange blieb ihm noch? Er dachte an das Forum, an den Studenten, an Eugen. Und daran, was sie gemeinsam erreichen könnten. Ein Zeichen setzen. Davon hatte Eugen geredet. Eugens Hass war politisch motiviert, was aber war sein Hass? Gegen wen richtete er sich? Eugen würde nie bei diesen Leuten einkaufen. Er aber hasste den Bäcker, der ihn nach seinem Namen gefragt hatte, weit mehr als die Angestellten im kleinen Laden. Eugen war ein Einzelgänger. Er war ein Einzelgänger. Wahrscheinlich verstanden sie sich deshalb so gut. Als er das Treppenhaus hochging, wusste er, dass er sich nicht auf andere verlassen konnte und wollte. Es war an der Zeit zu handeln. Solange er noch konnte.